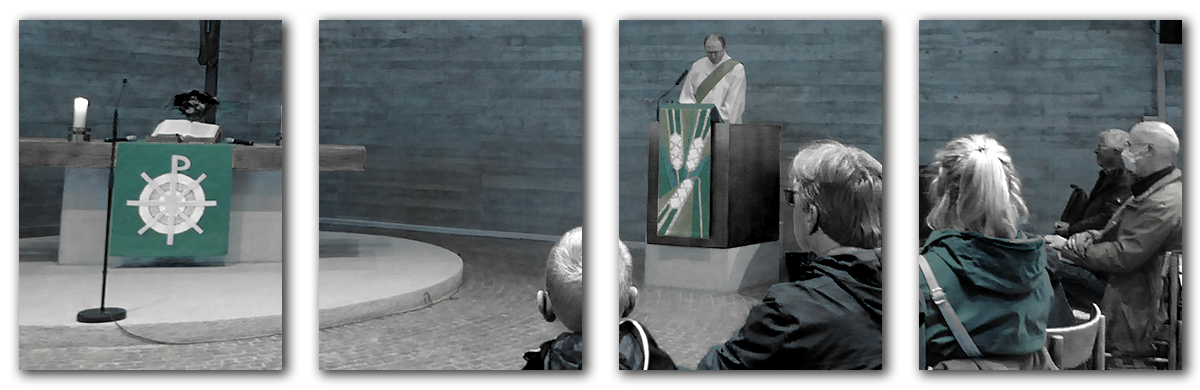Am 25. September 2022
EVANGELIUM: Johannes 4, 5-42
Ich war im Mai mit einem Bekannten in einer fremden Stadt unterwegs. Bei unserer Stadtbesichtigung gingen wir unter anderem in die dortige Kirche. In der Kirche wurde gerade ein Gottesdienst gefeiert. Mein Bekannter ging nach kurzer Zeit wieder raus aus der Kirche. Ich folgte ihm, weil ich den Gottesdienst nicht stören wollte. Draußen sagte mein Bekannter zu mir: „Ich ertrage dieses katholische Getue einfach nicht mehr!“
Er schimpfte noch ein wenig, blickte mich dann fragend an und sagte: „Ich weiß ja nicht, wie Du dazu stehst?!“ Ich sagte: „Du, ich werde im nächsten Monat zum katholischen Diakon geweiht. Also für mich ist Kirche schon wichtig.“ Er war dann sehr betroffen und hat sich mehrmals entschuldigt – er dachte, dass er mich verletzt hätte. Wir sind zunächst schweigend weiter gegangen. Nach einer Weile sagte er: „Ich habe neulich nochmal die Bergpredigt gelesen. Irgendwie bekomme ich das, was da steht nicht mit dem zusammen, wie ich die Kirche erlebe.“ Ich konnte ihm da nicht widersprechen. „Die Liebe Christi bewegt, eint und versöhnt die Welt.“ Das war das Thema der 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen. Die hat vor ein paar Wochen in Karlsruhe getagt. „Die Liebe Christi bewegt, eint und versöhnt die Welt.“ Das ist auch das Thema unseres Gottesdienstes. Als ich über meine Predigt zu diesem Thema nachgedacht habe – da ist mir als erstes in den Sinn gekommen: Vermutlich würden viele Menschen dieser Aussage widersprechen wollen. Vor allem, wenn sie dabei an die Kirche denken. Oder an ihre Erfahrungen mit der christlichen Religion. So wie mein Bekannter. Er ist in einer Patchworkfamilie aufgewachsen – in einem bayerischen Dorf. In einem Dorf, in dem man ganz genau wusste, wie eine „gute katholische“ Familie zu sein hat. Sicher nicht wie eine Patchworkfamilie: Geschieden und wiederverheiratet. Kinder mit verschiedenen Müttern und verschiedenen Vätern. So eine Familie wird dann gerne ausgegrenzt. Und so entstehen bei den Betroffenen Verletzungen. Verletzungen, die tief gehen. Es gibt immer wieder Fälle, bei denen sich Christen als Richter sehen und glauben urteilen zu dürfen oder gar müssen, wie andere Menschen zu leben haben – auch, wie Nichtchristen zu leben haben. Immer wieder führt das zu Verletzungen und Empörungen. Schauen wir nach Brasilien. Ein brasilianisches Mädchen wurde seit dem 6. Lebensjahr von ihrem Onkel vergewaltigt – und mit 10 Jahren von ihrem Vergewaltiger schwanger. Katholische und evangelikale Gruppen übten massiven Druck auf das Mädchen aus, nachdem eine katholische Politikerin den Namen und den Wohnort des Mädchens veröffentlich hatte. Die Gruppen versammelten sich vor dem Elternhaus des Mädchens, vor Krankenhäusern. Sie sorgten dafür, dass das Mädchen und ihre Eltern eine weitere Hölle durchmachen mussten – um zu verhindern, dass das Mädchen abtreibt. So wichtig mir der Schutz des ungeborenen Lebens ist: Wer bin ich, dass ich darüber richten könnte, wer hier das größere Opfer ist: Das 10-jährige Mädchen oder das ungeborene Leben? Wie könnte ich da mehr tun, als für das Mädchen und die Familie zu beten? Schauen wir in die USA: Dort wollen christliche Fundamentalisten allen Menschen eine bestimmte Lebensweise aufzwingen – beispielsweise was Familienplanung betrifft. Oder schauen wir auf den Ukraine-Krieg: Der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche Kirill rechtfertigt den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Der Krieg sei ein Abwehrkampf gegen den Westen und seine verkommene Moral. Gegen den Westen, der die Menschen auf den Pfad der Sünde führe. Ein Zeichen dafür sei die Gay-Pride-Parade. Die Vereinten Nationen zählen bislang ungefähr 400 Kinder, die im Krieg getötet worden sind. Sie zählen mehr als 12,3 Millionen geflüchtete Menschen. Wir hören fast täglich in den Nachrichten von zerstörten Schulen und Kindergärten, Schwangeren die in U-Bahn-Schächten ihre Kinder in einen Krieg hineingebären müssen. Nicht wissend, ob ihre Kinder überhaupt eine Zukunft haben werden. Familien, die zerrissen sind, weil die Männer das Land nicht verlassen dürfen. Und das ist aus Sicht eines christlichen Geistlichen notwendig, weil Menschen, deren Rolle in Gottes Heilsplan wir vielleicht nicht verstehen, tanzend durch die Straßen ziehen? Im Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 12, heißt es: „Doch es gibt nur einen Gesetzgeber und Richter: Gott. Er hat die Macht, zu retten oder zu vernichten. Wer aber bist du, dass du deinen Mitmenschen verurteilst?“ Und Jesus sagte: „Ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt“, Matthäus 7, Vers 1. Ich habe einem Mitbruder erzählt, dass ich über dieses Thema heute predigen darf: „Die Liebe Christi bewegt, eint und versöhnt die Welt“. Und dass mir vor allem negative Beispiele einfallen. Beispiele, bei denen Christen polarisieren. Die spalten statt zu einen. Christen, die nicht durch ihr eigenes Leben Zeugnis von ihrem Glauben ablegen, sondern die vor allem anderen eine bestimmte Lebensweise aufzwingen wollen. Mein Mitbruder antwortete mir: „Wo die Liebe Christi wirklich durchdringt, dort gibt es auch Versöhnung und Einigung.“ Und hier liegt, denke ich, der erste Teil des Schlüssels. Der Schlüssel dafür, warum die Liebe Christi oft nicht als versöhnend und einend wahrgenommen wird. Da wo Menschen sich und ihre Sichtweise in den Vordergrund stellen. Die in ihrem Glauben nicht mehr zweifeln, sondern meinen im Besitz der absoluten Wahrheit zu sein. Da wo Menschen Macht gegen Andersdenkende ausüben. Da scheint eben nicht die Liebe Christi durch. Da zeigt sich nicht Gott, sondern der Mensch. Der Mensch mit seinen Schwächen. Der zweite Teil des Schlüssels liegt aus meiner Sicht im heutigen Evangelium. Schauen wir also auf die Begegnung der Frau aus Samarien mit Jesus am Brunnen. Da trifft die Samariterin am Brunnen auf Jesus. Und wird überraschend von ihm angesprochen. Überraschend für die Frau ist das aus zwei Gründen. Zum einen: Es gehörte sich damals eigentlich nicht für einen Mann, in der Öffentlichkeit mit einer Frau zu sprechen. Aber andererseits war es üblich, dass Männer an Brunnen um Frauen geworben haben. Da das Wasserschöpfen Frauenarbeit war, war der Brunnen natürlich ein bevorzugter Aufenthaltsort von Frauen. Wo hätte ein Mann also besser auf eine Frau treffen und um sie werben können? Zum anderen gab es eine Feindseligkeit zwischen Juden und Samaritern. Samariter gehörten zwar auch zum Volk Israel und glaubten an denselben Gott. Aber für die Samariter waren nur die fünf Bücher Mose bindend. Außerdem gab es Unterschiede im Tempelkult. In dem Dialog, der bei der Begegnung zwischen Jesus und der Frau entsteht, erkennt die Frau erst nach und nach, wen sie da vor sich hat. Und Jesus geht ihr Tempo mit. Er wirbt um sie – nicht so, wie ein Mann um eine Frau wirbt. Er wirbt darum, dass sie Gottes Gegenwart in ihm erkennt – und zum Glauben an ihn kommt. Die erste Erkenntnis der Frau ist: Du – also Jesus – bist ein Jude. Die zweite Erkenntnis: Du bist mehr als Vater Jakob. Drittens: Du bist ein Prophet. Viertens: Du bist der verheißene Messias. Hätten wir die Erzählung aus dem Johannes-Evangelium eben noch weitergelesen, dann wäre fünftens gekommen: Du bist der Retter der Welt. Im Verlaufe dieses Kennenlernens wächst in der Frau eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die über die Befriedigung körperlicher Bedürfnisse hinausgeht – hier die Stillung des Durstes. Eine Sehnsucht nach einem erfüllten und sinnvollen Leben. Für diese Sehnsucht brauchte es die Begegnung mit Jesus – und zwar mit einem behutsamen und gütigen Jesus. Jesus gibt der Frau den Raum, den sie braucht, damit sie zum Glauben an ihn kommen kann. Er hätte ja auch sagen können: „Pech für Dich, dass Du Samariterin bist – Du kommst direkt in die Hölle!“ Oder: „Geh gefälligst in den Tempel in Jerusalem. Ansonsten ist Dein Gebet nichts wert!“ All das macht Jesus nicht. Er versöhnt und eint somit Juden und Samariter in seiner Person. Der zweite Teil des Schlüssels, warum die Liebe Christi oft nicht als versöhnend und einend wahrgenommen ist also aus meiner Sicht: Es braucht diese Begegnung mit Jesus. Es braucht diese Begegnung damit jemand sein Leben – das vielleicht in christlichem Sinne sündhaft ist – ändern kann und auch will. Ohne diese Begegnung wird keine Bereitschaft bestehen, sich von christlicher Seite Vorschriften machen zu lassen. Das kennen wir auch aus der Erzählung vom Zöllner Zachäus: Erst als Zachäus Jesus begegnet, kehrt er um und ändert sein Leben. Oder der blinde Bettler Bartimäus: Auch er muss Jesus erst begegnen, damit er sehend wird und Jesus nachfolgt. Was heißt das alles nun für uns? Jesus hat uns gesandt, den Menschen das Evangelium, die frohe Botschaft, zu verkünden. Im Markus-Evangelium heißt es: „Geht in die ganze Welt hinaus. Verkündet allen Menschen die Gute Nachricht. Wer glaubt und sich taufen lässt, den wird Gott retten. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen.“ Jesus hat uns nicht ausgesandt, um über Menschen zu richten oder sie zu zwingen nach unseren Vorstellungen zu leben. Der Glaube ist ein Angebot an den Menschen. Und Gott schenkt uns die Freiheit, dieses Angebot anzunehmen – oder eben nicht. Unsere Aufgabe ist es, Menschen eine Begegnung mit Jesus zu ermöglichen. Das können wir durch unser persönliches Zeugnis. Eine Möglichkeit für dieses persönliche Zeugnis ist diakonisches Handeln. Es ist unsere Antwort auf Gottes Liebe, die wir erfahren dürfen. Vielleicht zeigt Ihnen der „Markt der Möglichkeiten“ draußen auf dem Kirchplatz neue Wege für Ihr diakonisches Handeln auf. Damit Sie mich nicht falsch verstehen: Zum Glaubenszeugnis gehört selbstverständlich auch, dass wir für die Schwächsten eintreten. Und dabei auch Positionen beziehen, die nicht populär sind. Dass wir Dinge beim Namen nennen – auch wenn wir damit anecken. Dazu gehört für mich auch, Partei für das ungeborene Leben zu ergreifen. Auch Jesus hat immer wieder zur Umkehr ermahnt. Aber er hat niemanden zur Umkehr gezwungen. Um es zusammenzufassen: Da wo wir uns selbst zurücknehmen. Wo wir die Liebe Jesu Christi durch uns durchscheinen lassen – und damit eine Begegnung mit IHM ermöglichen. Dabei aber den anderen die Freiheit lassen, diese Begegnung anzunehmen oder abzulehnen. Oder auch eigene Wege bei dieser Begegnung zu gehen. Da kann Versöhnung und Einheit gelingen. Da ist der Friede nicht mehr weit. Und vielleicht muss dann auch mein Bekannter nicht mehr schimpfend aus der Kirche laufen. Amen
Diakon Markus Lubert